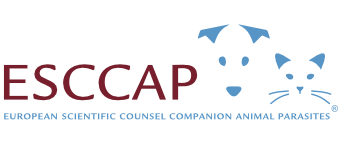Frage aus der Tierarztpraxis:
Wir haben einen hartnäckigen Fall mit immer wieder positivem Giardien-Nachweis (Junghund in einem Tierheim), der auch nach mehrmaliger Panacur-Gabe (5 Tage, 5 Tage Pause, 5 Tage) und auch Metronidazol-Gabe wieder im Schnelltest (Speed Giardia Virbac) positiv war.
Was können Sie uns für die weitere Behandlung empfehlen? Klinisch ist der Hund seit längerem unauffällig, der Kot immer geformt. Und was für andere Diagnostik-Möglichkeiten wären sinnvoll? Wann testet man nach Ende der Therapie (im Moment Metronidazol, Dosierung nach Clinipharm (15 – 25 mg/kg 1 – 2 × täglich während 5 – 7 Tagen)?
Hohe Hygieneanforderungen werden bereits umgesetzt (separater Auslauf, sofortige Kotaufnahme, etc.)
Antwort ESCCAP CH:
Giardien-Befall in Situationen mit Gruppenhaltung ist hartnäckig und mühsam zu bekämpfen. Unabhängig von der Medikamentengabe kann es zu wiederholter Giardia-Ausscheidung kommen. Insbesondere jüngere Tiere sind sehr häufig Ausscheider.
Die ausgeschiedenen Giardia-Zysten sind sehr resistent und können bei feucht-kühler Umgebung sehr lange überleben und zu Reinfektionen führen. Auch Zysten im Hundefell können möglicherweise zu Reinfektionen führen. Zudem scheiden etwa bis zu einem Drittel der Hunde Giardien-Zysten aus, ohne dass sich dies mit Durchfall manifestiert.
Die verschiedenen diagnostischen Tests, die häufig durchgeführt werden und Kopro-Antigen nachweisen, sind sehr sensitiv: Sie weisen nicht nur ganze Zysten, sondern auch Zystenbestandteile nach. So kann es sein, dass der nachgewiesene „Befall“ nur noch aus Überresten besteht, die noch aus dem Gastrointestinaltrakt ausgeschieden werden müssen.
Aus diesen Gründen kann man sagen:
Behandlung mit Fenbendazol oder Metronidazol als Wirkstoffe, beides gleichwertig (sowie weitere Möglichkeiten). Wichtig sind die Begleitmassnahmen, welche die Behandlung begleiten. Behandlungsprotokolle mit mehrmaliger Behandlung anwenden.
Dennoch haben wir die Erfahrung gemacht, dass auch in einer Versuchstierhaltung mit optimalen Möglichkeiten zur Durchführung aller Massnahmen, inkl. Hunde shampoonieren anfangs und Ende Behandlung, es trotzdem wieder zu Giardia-Nachweis kam. Natürlich musste dabei der GESAMTE Bestand allen Massnahmen ausgesetzt werden.
Um nicht unendlich Tiere zu behandeln und gegen Windmühlen zu kämpfen, muss man deswegen auch die klinische Auswirkung mitbetrachten: Wenn der Hund asymptomatisch ist und keinen Durchfall hat, hat man das Ziel eigentlich erreicht.
In einer Praxis-Situation sind Tierärzte mit der Zeit häufig pragmatisch, und bei Abheilung des Durchfalls testen sie evt. gar nicht mehr… Falls doch nochmals getestet wird, sollte man dies frühestens nach ca. 10 Tagen nach Ende der Behandlung machen, bei Kopro-Antigentests eher länger.
Das Institut für Parasitologie der Universität Zürich führt auch den direkte Zystennachweis mit der SAF-Methode durch. Hierfür brauchen Sie ein Röhrchen, welches die SAF-Lösung bereits enthält (mit Formalin, welches die Zysten fixiert).
Da diese Problematik äusserst häufig ist, haben wir im Rahmen von ESCCAP ein Factsheet produziert, das grossen Anklang findet:
Hilfreich ist auch die Guideline Nr. 6, Bekämpfung intestinaler Protozoen:
06/18, Prof. Manuela Schnyder
Präsidentin, ESCCAP Schweiz